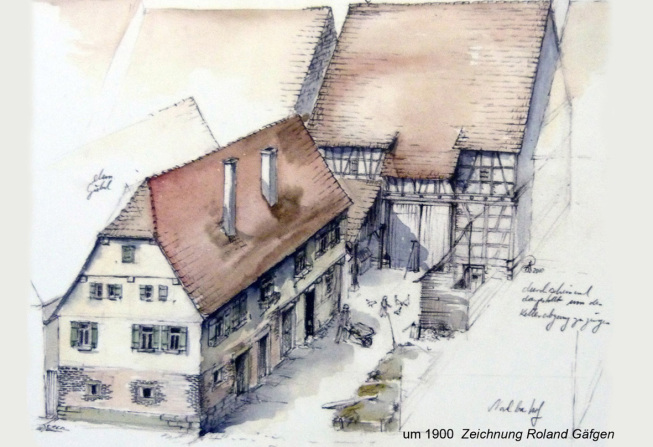
Schneider
Schneider
"Der friert wie ein Schneider"
In alter Zeit konnte man seine Kleidung nicht einfach in einem Laden kaufen. Anzüge, Mäntel, Westen oder Hosen wurden vom Schneider nach Maß gefertigt. Die hohe Kunst des Handwerkers bestand im guten Zuschnitt - daher sagen wir: Schneider (nicht Näher).
Früher bestellte man sich den Schneider oft ins Haus, der dann in der Stube am Esstisch arbeitete oder in der kalten Scheune. Im "Schneidesitz" arbeiten verhinderte ein Verschmutzen des Kleidungsstückes.
Der Schneider verarbeitete meist handgewebte selbst gefertigte Stoffe. Für die Männer überwiegend in schwarz. Der für die Hochzeit angefertigte Kirchenrock wurde oft ein ganzes Leben lang getragen. Wurden bestickte oder mit Samt verbrämte Jacken oder Westen gewünscht, musste der Schneider "Sticker" anwerben.
Schneider waren oft schwächliche, kränkliche Menschen, die der harten Feldarbeit nicht gewachsen waren (Siehe das Märchen vom "tapferen Schneiderlein"). Mehr schlecht als recht verdienten sie ihren Lebensunterhalt.
Wer "gut betucht" war, leistete sich gekauften, weichen, warmen. gewalkten Wollstoff (z. B. aus Calw, Augsburg, Weil der Stadt) und ließ daraus seine Kleidung anfertigen.
Diese wurde zugeschnitten, geheftet, anprobiert, versäubert, gefüttert und genäht. Für einen Anzug brauchte man rund 60 Stunden.
Weibliche Kleidungsstücke oder die Aussteuer für heiratsfähige Töchter fertigten überwiegend Näherinnen an. Mit Hilfe von Nähmaschinen ging das Nähen leichter und vor allem viel schneller.




















